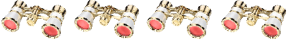Puccinis Turandot
in der Bayerischen Staatsoper
4 von 5 Operngläsern
Prädikat: Sehr sehenswert!
Große Show – aber zuviel des Guten!
30 Prozent weniger Spektakel und diese Turandot wäre großartig!
Die Zeit: Irgendwann in einer düsteren Zukunft à la Terry Giliams „Brazil“, nur eben in China.
Der Ort: Ein mit Neon-Reklamen überzogenes Peking, auf dem man Schlittschuh
läuft (so eiskalt ist die Gesellschaft geworden), tagsüber der nächsten Hinrichtung entgegenfiebert
und nachts mit dem ipad im www surft.
Zum tieferen Verständnis der reizüberflutenden Inszenierung muss man in etwa wissen,
wer hinter dem Spektakel steckt: „La Fura dels Baus“ (auf deutsch: die Frettchen vom Baus)
ist eine katalanische Theatergruppe, die gerne bildgewaltige Großveranstaltungen organisiert,
wie die Massennacktszene in Tom Tykwers „Das Parfum“ oder die legendäre Eröffnungsfeier
der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona.
Seit einiger Zeit dürfen die „Fura“ nun auch den Dirigenten Zubin Metha zum Freundeskreis zählen.
Gemeinsam verwirklichten sie schon z.B. den Ring des Nibelungen in Valencia oder den
Tannhäuser an der Mailänder Scala. Nun also Turandot in München, und wieder spült es Zubin Metha
mit seinen liebgewordenen Frettchen im Kielwasser in die Oper.
Ich fürchte, so mancher Turandot-Liebhaber hätte das Baus’sche Getier aber lieber
genau dort, im Wasser, ersäuft. Denn diese Turandot gefällt nicht unbedingt. Sie ist vielmehr
jeden Streit wert. Die augenfälligsten kontroversen Argumente im Überblick:
DAGEGEN!
Es ist zu viel los. Ständig rollt, schlürft, tanzt, bewegt sich etwas. Dazu grelle Kostüme,
überfrachtete Licht-Installationen und dann noch diese 3D-Bilder, die langweilen oder nerven.
Dieses Geraschel, wenn das gesamte Publikum gleichzeitig die Pappbrillen aufsetzt,
um für eine Minute ein weitgehend überflüssiges Farbgewimmel zu sehen. Dann die Brillen
brav wieder absetzen und sich von dem Tohuwabohu auf der Bühne weiter
überfahren lassen. Wer die Musik der Turandot liebt, kann nur enttäuscht sein, denn es fällt schwer,
diese zu genießen. Das ist, als wollte man mitten auf dem Stachus eine Nachtigall
zwitschern hören. Geht nicht. Zuviel Getöse überdeckt die Melodie.
DAFÜR!
Turandot wurde endlich mal ent-kitscht. Wo sonst die emotionskalte Prinzessin von den
triefenden Gefühlen der Liebe überrumpelt wird, wirft Carlus Padrissa von
Fura dels Baus statt angestaubter Bühnenromantik eine moderne Parabel auf die Bühne.
Diese Turandot steht für ganz China: eine radikale Kultur-Studie, die Nostalgie und
Märchen-Stimmung ausmistet, bis nur noch das nackte Fragment einer technokratischen,
emotional verödeten Gesellschaft stehen bleibt. Vor diesem Bezug macht es Sinn,
dass Neonreklamen und Kostüme miteinander um die Wette schreien, die Bühne so gut wie nie
zur Ruhe kommt und der Zuschauer im Sog dieser futurstischen Großstadt hinweggespült
wird. Das düstere Szenario vermittelt die Botschaft aufs Beste!
Wie gesagt, über so ein Spektakel ließe sich herrlich an Münchner Stammtischen streiten.
Dem einen gefällts, dem anderen halt net. Eines kann man aber sicher pauschal festhalten:
Wer Turandot noch nie gehört hat, kann auch nach diesem Opernbesuch sagen,
er habe sie noch nie gehört. Denn Fakt ist, dass die Musik im Getummel des Spektakels
verloren geht. Im Grunde erlebt man hier eine Musical-Version der Oper.
Große Show außenrum, das Substantielle geht aber der Opulenz zuliebe verloren.
Dabei gibt es durchaus wundervolle Bilder zu sehen:
Etwa, wenn der Prinz von Persien kurz vor seiner Hinrichtung hereingerollt wird –
dutzende Kinder mit Laternen zerren ihn an meterlangen Ketten hinter sich auf einem
fahrbaren Metallturm her. Oder, wenn die drei Minister sich an ihr Zuhause erinnern,
die bescheidene Hütte am See, vom Bambus umgeben. Sie singen vor einem Meer
aus weißen Styropor-Schädeln, die von darunter verborgenen Tänzern zum Wabern und
Wogen gebracht werden.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Dagegen scheint es schon arg bemüht, wenn zwei der Minister dann an Stahlseilen befestigt
vom Boden abheben und wie Zirkusartisten herumschweben. Überhaupt hat die
Inszenierung viel artistisches: Es wird getanzt, geschlittschuht, geklettert, an Seilen von der
Decke gehangen. Dass die Bilder nicht immer zur Musik passen und auch nicht unbedingt
Sinn machen müssen, scheint Fura dels Baus egal.
Tatsächlich fragwürdig ist die Idee mit den 3D-Brillen:
Dass der Megatrend aus dem Kino irgendwann die Opernbühne erreicht, war absehbar.
Bisher war ja die Video-Installation das Höchste der Gefühle.
Aber, wenn schon denn schon. Soll heißen: 3D an sich, Ja gerne! Aber dann bitte mit
Bildern auf der Bühne, die es lohnt, in dreideimensional gesehen zu werden.
In dieser Turandot sieht man im Grunde nur bunte Farbkreise und abstrakte Formen.
Die machen in 3D nicht mehr oder weniger her als mit normalem Auge.
Einzig zur großen Arie der Turandot „In questa reggia“ darf man sehen, wie eine junge Chinesin
Opfer eines Überfalls wird, eben wie Turandot es in ihrer Arie besingt. Für einen winzigen
Moment, als die 3D-Chinesin ihre Hand dem Publikum Hilfe suchend entgegenstreckt,
macht die 3D-Brille Sinn.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Trotzdem: Viel Lärm um nichts. Und die Pappbrille, die jeder Besucher
im Foyer überreicht bekommt, galt ja nun schon in den 1970’er Jahren als blöd.
Wer heute 3D guckt, etwa im Kino, ist längst viel modernere, bequemere und technisch
überzeugendere Brillen gewöhnt. Aber die dürfte man am Ende des Abends
natürlich nicht mit heimnehmen und als Andenken und Seitenmerker ins Programmheft klemmen.
Apropos Programmheft: Kaufen Sie sich eines!
Denn darin wird erläutert, was Carlus Padrissa von Fura dels Baus uns mit seiner Inszenierung
eigentlich sagen will. Ohne Hefterl wundert man sich eher.
Etwas Schönes möchte ich zum Schluß aber doch noch berichten:
Bei aller Hektik und allem Rumgezerre auf der übervollen Bühne gibt es doch noch ein paar
kleine Ruhe-Inseln im optischen Schneegestöber:
Als der Tenor sein berühmtes „Nessun dorma“ singt („Keiner schlafe!“), wachsen dutzende,
turmartig gestapelte Wohnzellen aus dem Boden, wie in der Zukunft asiatischer
Megacities durchaus vorstellbar. Und wirklich, die darin Sitzenden und Liegenden schlafen nicht,
sondern nach und nach „entzünden“ sich unzählige Laternen der Neuzeit: Ipads, oder
Tablett-PCS. Überall werden emotionslose Gesichter von blauem Licht erhellt,
was eine wundervolle Licht-Stimmung auf die Bühne zaubert.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Zweites Highlight ist, wie sollte es anders sein, der Tod der Liu. Über mehrere Minuten
baut sich ein optisch hinreißendes wenn auch brutales Stilleben auf, voll poetischer An- und Demut.
Dieser Moment markiert nicht nur den Wandel der eisigen Turandot, sondern
erlöst auch den Zuschauer von rund zwei Stunden Bühnen-Feuerwerk. Durchatmen,
genießen, und sich den letzten Tönen der Musik hingeben.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Denn ganz folgerichtig lassen Fura dels Baus und Zubin Metha die Oper an dieser Stelle enden.
Soll heißen, exakt dort, wo Puccini starb – und seine letzte Oper nicht mehr vollenden konnte.
Meistens wird heutzutage der von Franco Alfano aus Puccinis Skizzen konstruierte
Schluß aufgeführt. In München endet die Turandot mit Lius Opfertod. Und das ist auch gut so.
Denn nach dem erlösend-stillen Untergang der Sklavin wieder die volle Fura-Maschinerie
anlaufen zu lassen und die letzte Viertel Stunde es auf der Bühne noch einmal so richtig krachen zu lassen,
würde dem schönsten Moment des Abends sein Strahlen nehmen.
Und so stolpert man, rund zwei Stunden optisch überladen und musikalisch nicht unbedingt befriedigt,
aus dem Opernhaus – und fühlt doch den unerträglichen Schmerz der Sklavin Liu noch ein paar
Stunden nach. In der Optik würde man das „Blindflecken“ nennen: Nachdem man zu lange auf eine
grelle, bunte Lichtquelle geschaut hat, tanzen einem noch Minuten später bunte Flecken vor
den Augen, wenn man sie schließt, um endlich Ruhe zu finden...
Diese Turandot ist nichts für Münchner, die die Oper nicht kennen und zum ersten Mal sehen,
bzw. hören wollen. Wer Turandot aber in- und auswendig kennt, mag sich freuen, einen
überfrachteten aber entkitschten Bilderreigen zu erleben.
Und auch hier gibt es als kleinen Vorgeschmack einen kleinen „Trailer“ zum Angucken
(einfach auf den Pfeil in der Mitte des Bildes klicken):
Sollte das Video oben nicht funktionieren, gehen Sie bitte direkt über Youtube.de
(Einfach auf den Link klicken):
TURANDOT TRAILER